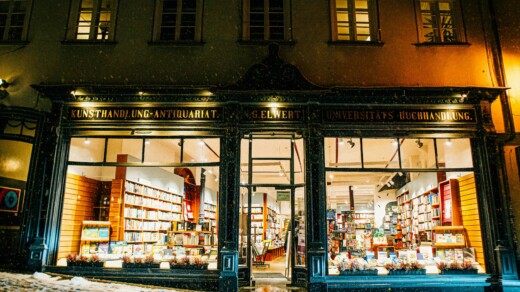Von Paris bis Kopenhagen, von New York bis Rio: Die Bildhauerinnen Isabelle Waldberg, Sonja Ferlov Mancoba und Maria Martins waren zwischen 1930 und 1970 in den höchsten surrealistischen Kreisen unterwegs und aktive Mitgestalterinnen der internationalen Avantgarde. Doch die männlich dominierte Kunstgeschichte ließ sie in Vergessenheit geraten – bis heute. Mit „In Her Hands“ holt das Bucerius Kunst Forum nun unter der kuratorischen Leitung von Katharina Neuburger und Renate Wiehager die drei Künstlerinnen zurück auf die große Bühne – und bringt die Wirkungskraft und Vielfalt von deren Schaffen in rund 100 Skulpturen, Gemälden, Zeichnungen und Fotos zur Ansicht. Den ersten Ausstellungsraum füllen viele kleinere Bronzen aus den Händen von Isabelle Waldberg, häufig abstrahierte Körper, deren Materialität und Plastizität bis ins Detail betont werden, da sie hier in einem besonderen Licht erscheinen dürfen, das sonst weniger Museumsräume durchflutet: Tageslicht. Generell zeichnet die verschiedenen Ausstellungsbereiche, die jeweils einer der drei Künstlerinnen gewidmet sind, eine lichte Durchwirkung aus, da sie durch helle, semi-transparente Vorhänge verbunden sind – so ähnlich wie es auch schon die Surrealistinnen und Surrealisten in ihrer Zeit praktizierten. Im Glanz künstlicher Scheinwerfer wiederum stechen einige Arbeiten von Waldberg heraus, deren Fragilität in krassem Kontrast zu ihren Bronzen stehen: feingliedrige Stabkonstruktionen aus Buchenholz oder Metall, die teils an der Wand, teils von der Decke hängen. Auch Sonja Ferlov Mancoba nutzte Holz für kleine Objektgruppen und setzte sich außerdem spielerisch mit tierischen Formen auseinander – zumindest in ihrem Frühwerk.
In Her Hands: Bedeutung weit über den Surrealismus hinaus
Während der Kriegsjahre, in denen ihr Mann Ernest Mancoba, ein aus Südafrika stammender Künstler, interniert war, konnte sie unter prekären Lebensverhältnissen in Paris nur bedingt produktiv sein. Umso bedeutender ist die große, keilförmige Bronze mit dem sprechenden Titel „Skulptur 1940-1946“, an der sie über Jahre hinweg gearbeitet hatte, und in deren optische Schwere und formale Verdichtung sich auch die Last der ungeheuren Kriegsgewalt und die damit verbundenen Ängste eingetragen haben mögen. Erst in den 60er-Jahren kehrte Mancoba wieder zu ihrer formalen Experimentierfreude und einem Thema zurück, mit dem sie sich schon früher beschäftigt hatte: mit außereuropäischer Kunst, insbesondere mit Masken. Für die Brasilianerin Maria Martins spielten ab den 40er-Jahren vor allem Mythen aus dem Amazonasgebiet eine Rolle – ob nun motivisch, im Werktitel oder als erweiterter Ideenkontext für ihre Skulpturen, bei denen sie oft über Materialexperimente mit Bronze organische Formen und vegetative Strukturen erzeugte, die sowohl figürliche als auch abstrakte Elemente aufweisen. Waldbergs, Mancobas und Martins’ Objekte wurden schon zu Lebzeiten gemeinsam ausgestellt, ebenso tauchten in ihren sozialen Netzwerken immer wieder die gleichen Namen auf. Doch unklar bleibt, ob sich die drei auch persönlich kannten. So macht das Bucerius Kunst Forum vor allem deren Verbundenheit im Werk sichtbar – und damit auch deren Bedeutung weit über den Surrealismus hinaus.
Dieser Artikel ist zuerst in SZENE HAMBURG 04/2025 erschienen.