SZENE HAMBURG: Johann, du bist Musiker, Musikproduzent, Autor. Wenn dich jemand, der dich nicht kennt, fragt, was du beruflich machst, was antwortest du dann?
Johann Scheerer: Als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, habe ich immer gesagt, dass ich beruflich Musikproduzent bin, aber ein Hobby habe: das Schreiben. Ich bin mit dem Schreiben aber erfolgreicher als als Musikproduzent, und irgendwie fühlt sich das für mich mittlerweile ein bisschen kokett an, wenn ich das als Hobby bezeichne. Aber alles, was ich mache, macht mir wahnsinnig viel Spaß, daher fühlt sich das alles nicht an wie ein Job.
Aber das sind doch die allerbesten Voraussetzungen …
Oder die allerschlimmsten, weil man dadurch aus dem Arbeiten gar nicht mehr rauskommt. Das wird ja auch in meinem aktuellen Buch verhandelt: Dass es so schwierig ist, Leuten begreiflich zu machen, dass das Arbeit ist. Dieses wochenlange vermeintliche Nichtstun, wenn man ein Buch schreibt, aber noch kein Ergebnis hat, und man anderen noch nicht mal genau erklären kann, worum es im neuen Buch eigentlich geht. Teil der Arbeit ist zudem ja auch spazieren zu gehen und darüber nachzudenken.
Während du dich auf „Wir sind dann wohl die Angehörigen“ aus dem Jahr 2018 mit der Entführung deines Vaters aus Sicht deiner Familie auseinandergesetzt hast und in „Unheimlich nah“ über dein von Personenschützern begleitetes Leben geschrieben hast, ist „Play“ nun dein erster wirklich fiktiver Roman. Hast du das als schwieriger empfunden?
Ich schreibe immer über das, was mich bewegt und das, was ich kenne. Ich schöpfe aus einem Pool von Emotionen, die mir irgendwie nahe sind. Auch das Buch trägt daher viel von mir in sich, aber auf eine derart verdichtete und abstrakte Art, dass es sich streckenweise auf eine ganz gute Art und Weise fremd anfühlt.
Das ist der Job: Die intensive Befassung mit Themen ist keine Ablenkung, sondern notwendig beim Schreiben
Das Buch handelt von jemandem aus der Musikindustrie.
Es ist insofern autobiografisch inspiriert, als dass es in den letzten 20 Jahren immer wieder Momente gab in meiner Arbeit mit Musikerinnen und Musikern, in denen ich dachte: Die Geschichte müsste ich mal aufschreiben. Ich habe Anfang 2023 mal ein Buch gelesen: „Der Briefwechsel“, der zwischen dem komplizierten Autor Thomas Bernhard und dem ehemaligen Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld stattgefunden hat. Darin gibt es teilweise Unterhaltungen, die auch ich schon geführt habe oder führen könnte. Ich fand es faszinierend zu lesen, wie unkonventionell dieser Verleger vorgehen musste, um seinen Autor bei Laune zu halten, um ein Setting zu schaffen, bei dem dieser Autor in der Lage war, überhaupt Kunst zu produzieren. Literatur zu schreiben. Das hat mir total geholfen. In der Vergangenheit habe ich oft gedacht, dass mich diese ständige, intensive Auseinandersetzung davon abhält, meinen Job zu machen. Bis ich nach Lektüre dieses Buches gemerkt habe: Das ist der Job.
Ich schöpfe aus einem Pool von Emotionen, die mir irgendwie nahe sind
Julian Scheerer
Das klingt in der Tat aufschlussreich.
Ich fand außerdem irre, dass es da diese starke Parallele zum Kinder großziehen gibt. Man ist ja die ganze Zeit völlig im Arsch. Und man muss sich als Individuum mit seinen persönlichen Bedürfnissen als Elternteil bis zu einem gewissen Grad aufgeben. Denn wenn du dich ständig gegen die Bedürfnisse deiner Kinder sperrst, weil du selber Bedürfnisse hast, dann wird das nichts mit dem gemeinsamen Großwerden. Und genauso ist es auch in der Künstlerarbeit. Dieses Spannungsfeld hat mich interessiert, weil ich gemerkt habe; Da gibt es doch erstaunliche Gemeinsamkeiten zwischen den Ansprüchen kleiner Kinder an ihre Eltern und den Ansprüchen von Künstlern an ihre Mitarbeiter, Manager und so weiter. Und wenn man diese Erkenntnis mal weiterdenkt und sogar noch zusammenbringt, dann könnte das vielleicht ganz gute Unterhaltung werden. So ist dieses Buch entstanden.
Am Anfang von „Play“ steht unter anderem ein Zitat des Rappers Apsilon aus dessen Song „Baba“, in dem es heißt: „Mein Baba hat ein’ starken Rücken. Der schleppt viel mit sich rum bei Nacht./Ich wünscht, er wär ein bisschen schwächer. Dann hätt’s ihn nicht kaputtgemacht.“ Bezieht sich das auf den Inhalt deines Buches oder richtet sich das mehr an deinen eigenen Vater?
Dieser Song ist mir richtig reingegangen. Die Gen-Z würde sagen: Ich fühle das. Und natürlich betrifft das meinen Vater, aber auch mich als Vater und wahrscheinlich 99 Prozent der Väter: dieses Männerbild, das wir vorgelebt bekommen haben in den Jahrzehnten, in denen wir aufgewachsen sind – bei mir waren das die Achtziger und Neunziger. Da sind wir mit einem Männerbild aufgewachsen, das keine Schwäche zugelassen hat und emotional einfach nicht ansprechbar war. Aber das hat natürlich Konsequenzen und dazu geführt, dass es vielen Generationen von Männern schwerfällt, emotional available zu sein und soft sein zu dürfen. Deswegen finde ich diesen gigantischen Song von Apsilon wahnsinnig wichtig. Übrigens auch, weil er eine Migrationsgeschichte hat und es in der migrantischen Gesellschaft auch Männerbilder gibt, die noch viel kantiger sind.
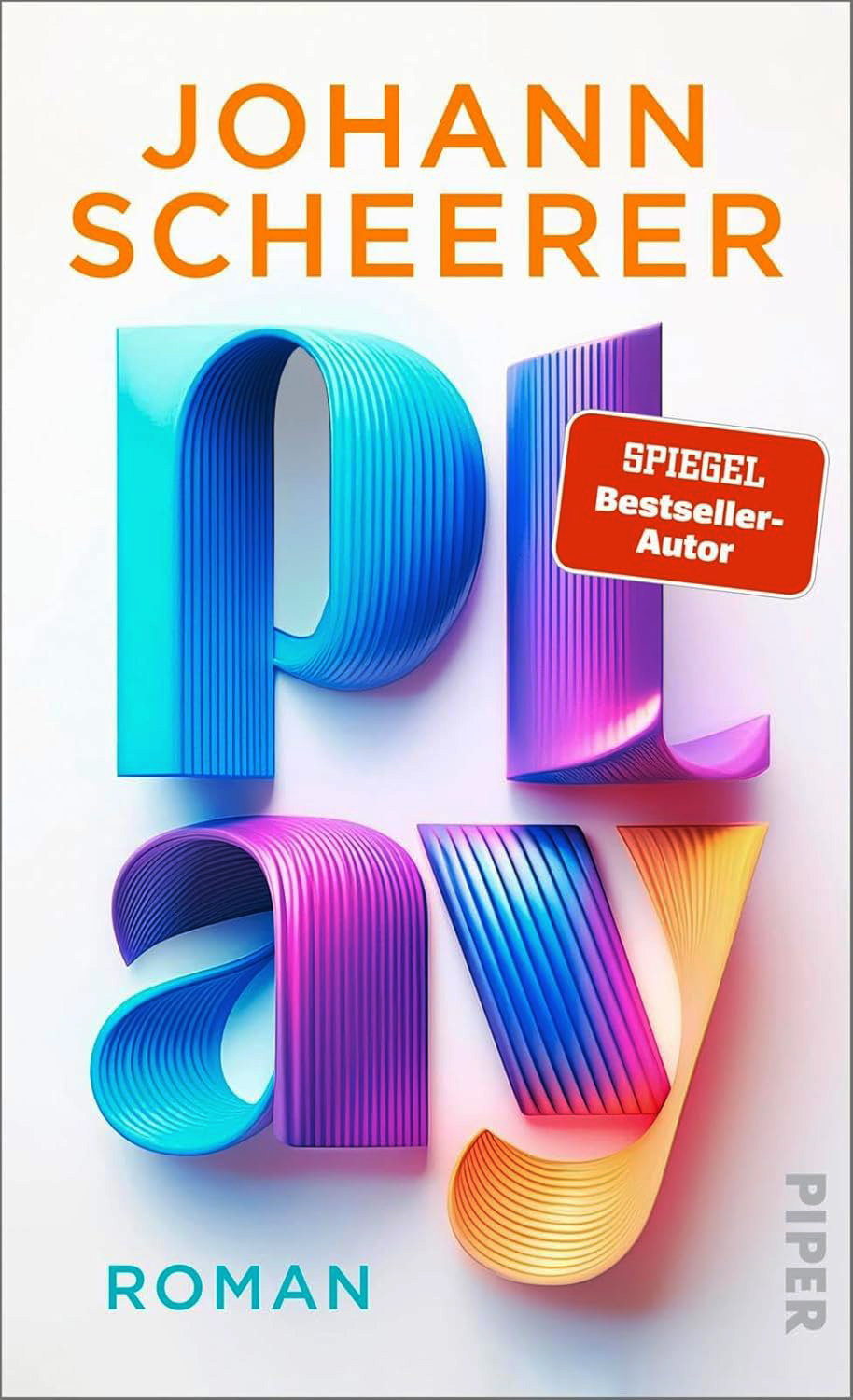
Du hast einen bekannten Vater, auf den du sicher häufig angesprochen wirst, und hast mit vielen bekannten Persönlichkeiten zusammengearbeitet wie Peter Doherty, Rocko Schamoni, Wolf Biermann oder Frank Spilker. Hast du es manchmal als schwierig empfunden, gerade hinsichtlich Medien und der Öffentlichkeit, dir und deinem Schaffen unabhängig davon die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen?
Es geht mir überhaupt nicht darum, das Spotlight auf mich zu richten, nur phasenweise darauf, was ich tue. Mir ist wichtig, durch die Inhalte, die ich literarisch oder musikalisch erzeuge, wahrgenommen zu werden – und dem steht diese Entführungsgeschichte natürlich im Weg. Das ist der Grund, warum ich mein erstes Buch geschrieben habe, um die Deutungshoheit dieser Geschichte bei mir zu haben und es aus dem Weg zu schreiben. Das ist mir nicht abschließend gelungen, weil diese Geschichte eine bizarre Übermacht hat, die meinem Vater noch viel mehr im Weg steht als mir. Weil es kein Gespräch gibt in der Öffentlichkeit, wo das nicht Thema ist. Und das ist natürlich ein Problem, und das wird nicht besser dadurch, dass es diesen irren True-Crime-Hype gibt und alle denken, Verbrechen sind bis zu einem gewissen Grad auch was abgefahren Cooles. Da muss es noch viel gesellschaftliche Arbeit geben, um zu verstehen, dass das ein kompliziertes Thema ist.
Das Schreiben weist starke Parallelen zum Kinder großziehen auf.
Julian Scheerer
Du bist in Hamburg geboren, aufgewachsen und lebst immer noch hier. Hattest du nie mal den Drang, wegzuziehen?
Ich habe früh Kinder bekommen, dann wird alles schwieriger. Außerdem hatte ich mein Studio. Aber ja: Kulturarbeit zu machen in Hamburg ist schon mühsam, da ist man in Berlin eigentlich besser aufgehoben. Gerade international muss man immer erklären, warum Hamburg auch eine coole Stadt ist. Hier ist alles so ein bisschen dörflich. Ich mag das aber gerne.
Hat Hamburg als Stadt auch einen Einfluss auf dich und dein Schaffen?
Ich habe eine große Abneigung gegen Lokalpatriotismus, weil es immer so was Dünkeliges hat, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Stadt auch eine Faszination und eine Schönheit hat. Ich mag Hamburg schon sehr.





