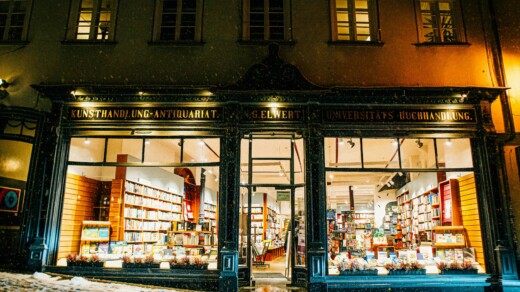Es gibt wohl kaum eine Hamburgerin oder einen Hamburger, der den Begriff Ochsenzoll nicht schon einmal gehört hätte. Für viele steht der Name bis heute sinnbildlich für eine geschlossene Psychiatrie. Umgeben von Mauern, Vorurteilen und einer gewissen Unbekanntheit. Dabei löst das Wort Psychiatrie allein bei vielen Bilder aus: düstere Flure, verschlossene Türen, eine Welt, die man lieber meidet. Wer jedoch das Gelände des Asklepios Klinikums Nord-Ochsenzoll betritt, erlebt etwas ganz anderes: eine offene Tagesklinik, bunte Flure, zahlreiche liebevoll ausgestattete Therapieräume und eine Gärtnerei, in der Patientinnen, Patienten und Fachkräfte gemeinsam arbeiten. Menschen, die hier vor allem eines suchen: Hilfe, Unterstützung und einen Ort, an dem sie ernst genommen werden.
Entwicklung der Klinik: Von der Kolonie für Geisteskranke zum modernen Maximalversorger
Gegründet wurde Ochsenzoll im Jahr 1893 als „Landwirtschaftliche Kolonie für Geisteskranke“. Die damalige Vorstellung von psychischen Erkrankungen war stark von gesellschaftlichen Vorurteilen und medizinischen Fehlannahmen geprägt. Darauf deutet auch der Standort hin. Am Rande der Stadt gelegen, abseits vom sozialen Treiben. Heute ist Ochsenzoll eine der größten psychiatrischen Einrichtungen Norddeutschlands und ein moderner Maximalversorger. Das Klinikgelände umfasst sechs hoch spezialisierte Kliniken – von der Akut- und Notfallversorgung über stationäre Behandlungen auf offenen oder geschützten Stationen bis hin zu tagesklinischen Angeboten. Sogar eine Online-Klinik ist Teil des Portfolios, die Patientinnen und Patienten digital betreuen kann und Therapiemöglichkeiten bereitstellt. Auch die geschlossene Psychiatrie sowie die Forensik gehören zum Gelände, werden an dieser Stelle allerdings nicht beleuchtet.
Der Alltag in Ochsenzoll ist vielfältig und individuell gestaltet. Ergänzend zu den medizinischen Angeboten können Patientinnen und Patienten etwa in der Gärtnerei arbeiten, die Parkanlagen pflegen oder an arbeitstherapeutischen Angeboten teilnehmen. „Dass selbst gemalte Bilder bei uns die Flure schmücken, sind Erfolgserlebnisse für Patientinnen und Patienten und erfüllen sie mit Stolz“, so Saskia Timm, Leiterin der Sozialtherapie in Ochsenzoll.
Um richtig zu diagnostizieren, ist das Verstehen unermesslich
Sarang Thakkar
Thereapieansatz: VR, Kultur und Gemeinschaft als Schlüssel

Ziel ist es, Menschen schrittweise auf ein selbstbestimmtes Leben außerhalb der Klinik vorzubereiten. Mit VR-Brillen-Therapie etwa werden Patientinnen und Patienten vor ihrer Entlassung der Suchtambulanz in realitätsnahen Szenarien auf mögliche Herausforderungen im Alltag vorbereitet. Auch kulturelle, kreative und sportliche Aktivitäten gehören zum Therapieangebot, genauso wie sozialtherapeutische Gruppen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Erkrankten abgestimmt sind. Sarang Thakkar, Leiter der Tagesklinik, weiß, wie wichtig es ist, im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen auch die kulturellen Hintergründe zu berücksichtigen. Aus diesem Grund gibt es beispielsweise eine Kochgruppe, die von türkischem Personal geleitet wird und Musliminnen und Muslimen eine Möglichkeit zum Austausch bietet. In den Behandlungen spielen Dolmetscherinnen und Dolmetscher eine wichtige Rolle: „Um richtig zu diagnostizieren, ist das Verstehen unermesslich“, so Thakkar.
Klinik öffnet ihre Türen: Begegnung statt Stigma
Ochsenzoll ist nicht nur Klinik, sondern auch ein Ort der Begegnung. Spaziergängerinnen und Spaziergänger können den Naturlehrpfad auf dem Gelände erkunden oder am Wochenende ein Stück Kuchen in der Cafeteria genießen. Gerade Nachbarinnen und Nachbarn, die unweit vom Klinikum wohnen, nehmen dieses Angebot gerne an. Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten, sie begegnen einander dabei auf Augenhöhe. Diese Öffnung ist Teil einer klaren Philosophie: Psychische Erkrankungen sollen entstigmatisiert werden, Betroffene nicht ausgegrenzt. Statistisch gesehen erkrankt jede vierte Person im Laufe ihres Lebens mindestens einmal an einer psychischen Erkrankung. „Wenn Sie sich in einem Bekanntenkreis von 20 Leuten umsehen und niemanden mit einer Erkrankung identifizieren können, kennen Sie nicht die Wahrheit“, so Professor Lammers, Leiter des Klinikums Nord-Ochsenzoll, der von vielen liebevoll auch „Schulleiter“ genannt wird. Psychische Erkrankungen gehören zu den häufigsten Gründen für Arbeitsunfähigkeit und sind längst Teil des gesellschaftlichen Alltags. Die Klinik setzt daher auf Transparenz, Information und Aufklärung, um die öffentliche Wahrnehmung nachhaltig zu verändern.
Klinik Nord-Ochsenzoll: zwischen alten Vorurteilen und moderner psychiatrischer Versorgung
Die Geschichte Ochsenzolls ist eng mit der gesellschaftlichen Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland verbunden. Aus einer kleinen „Kolonie“ (Angelika Obermeiner, Kommunikation und Marketing) ist ein hochmodernes, wissenschaftlich fundiertes Zentrum geworden, das Tradition und Fortschritt miteinander verbindet. Neben der medizinischen Versorgung pflegt die Klinik eine aktive Erinnerungskultur: Gedenkveranstaltungen für deportierte Patientinnen und Patienten und naturkundliche Führungen auf dem weitläufigen Gelände erinnern an die Vergangenheit und schaffen Bewusstsein für die Verantwortung, die mit psychischer Versorgung einhergeht.
Wir brauchen immer wieder kleine Leuchttürme der Sichtbarkeit
Professor Lammers
Der Name Ochsenzoll steht heute für weit mehr als alte Vorurteile. Er ist ein Synonym für eine moderne, differenzierte psychiatrische Versorgung, die Tradition, Innovation und Menschlichkeit miteinander vereint. Damit das so bleibt, braucht es immer wieder Aufmerksamkeit: „Wir brauchen immer wieder kleine Leuchttürme der Sichtbarkeit. Das können zum Beispiel Prominente sein, die mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit gehen und zeigen, dass nichts Schlimmes dabei ist, darüber zu sprechen“, so Lammers. Auf dem Klinikgelände wird deutlich, dass psychische Erkrankungen mitten unter uns existieren, dass es für Betroffene professionelle Hilfe gibt und dass der respektvolle Umgang mit psychisch erkrankten Menschen ein selbstverständlicher Teil des gesellschaftlichen Miteinanders sein sollte.