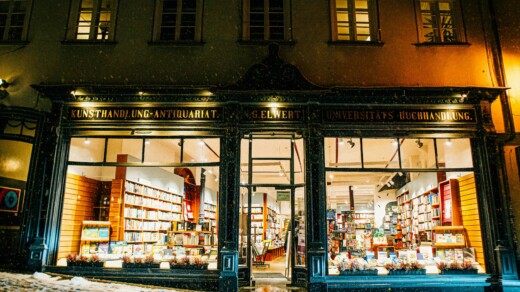Heutzutage weniger funktional und mehr ästhetisch bedeutsam, war die Speicherstadt einst Herzstück des internationalen Handels. Nach der Reichsgründung 1871 sollte auch Hamburg, bis dahin ein Zollausschlussgebiet, Teil des deutschen Zollvereins werden. Damit das möglich wurde, erklärte sich die Stadt bereit, einen Freihafen zu bauen. So konnte der Handel ungehindert florieren, denn Kaufleute durften ihre Importgüter dort weiterhin zollfrei lagern, veredeln und verarbeiten. Dieses Privileg sollte nicht verloren gehen – und so entstand die Speicherstadt. Hier lagerte Tee aus Indien, Kaffee aus Südamerika, Kakao aus Westafrika, Teppiche aus Persien und Gewürze aus aller Welt – ein Panorama globaler Warenströme, das sich in den Gassen des Viertels verdichtete.
Unschöne Anfänge: Vertreibung der Bürgerinnen und Bürger zugunsten der Speicherstadt

1883 fiel die Entscheidung für den neuen Lagerkomplex: Auf den Elbinseln Kehrwieder und Wandrahm, südlich der Innenstadt. Die Lage war ideal – gleich neben dem Sandtorhafen, damals einer der modernsten Umschlagplätze der Welt. Doch der Beschluss fiel dem Senat alles andere als leicht: acht zu sieben Stimmen stimmten für das Projekt. Grund: Mehr als 20.000 Menschen lebten dort – überwiegend Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter, aber auch Kaufleute. Sie mussten samt ihrer Familien ihre Wohnungen räumen, ohne eine Entschädigung dafür zu bekommen. Nur die Inhaberinnen und Inhaber bekamen Zahlungen von der Stadt. Die Familien zogen in alle Teile Hamburgs, zahlten höhere Mieten und hatten längere Arbeitswege. Für viele bedeutete das auch den Verlust ihrer Nachbarschaften, der vertrauten Hafenkneipen und der sozialen Netze, die das Leben in den engen Gassen prägten. Ein wirtschaftlicher Meilenstein für Hamburg – menschlich ein Tiefpunkt. Nur fünf Jahre dauerte der Bau des ersten Abschnitts – für die damalige Zeit bemerkenswert schnell. Zur feierlichen Eröffnung am 29. Oktober 1888 erhielten die Hamburgerinnen und Hamburger einen arbeitsfreien „Kaisertag“. Wilhelm II. kam nämlich persönlich, um das Handelszentrum einzuweihen. Die Oberaufsicht hatte Bauingenieur Franz Andreas Meyer, der den neugotischen hannoverschen Stil prägte und damit Erker, Schmuckgiebel und Sandsteinornamente einführte – Details, die bis heute den Charakter der Speicherstadt prägen. Fundament des Ganzen waren 3,5 Millionen Eichenpfähle, die bis zu zwölf Meter tief in den weichen Schlick gerammt wurden. Diese wurden als Basis genommen, da sie kaum zündbar waren und eine gute Stabilität boten. Die Speicher waren fünf bis sieben Stockwerke hoch, mit Lastenaufzügen ausgestattet und so konstruiert, dass Schuten die Fleete direkt anfahren konnten, um die Ware über hölzerne Schanzen in die Speicher zu ziehen. In den Blöcken gab es eigene Räume für unterschiedliche Güter, von getrocknetem Tee bis zu feuchten Orientteppichen, die in klimatisch geeigneten Hallen lagerten. Bis 1927 wuchs die Speicherstadt Abschnitt für Abschnitt auf 26 Hektar zwischen Baumwall und Oberhafen.
Mit dem Siegeszug der Containerschifffahrt in den 1970ern verlor die Speicherstadt ihre ursprüngliche Funktion
Nie zurück zur alten Größe: Zerstörung während des zweiten Weltkriegs

Als einer der wichtigsten Umschlagplätze Deutschlands blieb die Speicherstadt im Zweiten Weltkrieg nicht verschont. 1943 zerstörten Bomben große Teile der Anlage. Bis 1953 wurden etliche Gebäude im alten Stil wiederaufgebaut, andere verschwanden für immer, wieder andere entstanden neu, wie das Freihafenamt – ein markanter quadratischer Backsteinbau. Doch der Lagerkomplex fand nie wieder zu alter Größe. Mit dem Siegeszug der Containerschifffahrt in den 1970ern verlor die Speicherstadt ihre ursprüngliche Funktion. Zollfreie Lagerung wurde abgelöst, und insbesondere das Areal war zu klein für die immer größeren Schiffe und die rapide wachsenden Mengen an Gütern. Container benötigten weitläufige Terminals, Kräne und Flächen, die in den engen Fleeten der Speicherstadt nicht vorhanden waren. Der Hafen wanderte flussabwärts, die Speicherstadt musste sich neu erfinden. Stattdessen zogen Werbeagenturen, Gastronomien und Museen in die historischen Räume. Herkömmlich genutzt wird die Handelsfläche nur noch zur Lagerung von Teppichen. Doch die Speicherstadt hat neue Nutzerinnen und Nutzer gefunden: allen voran das Speicherstadtmuseum und das Miniatur Wunderland. Ersteres erzählt die detailreiche Geschichte der Speicherstadt mit vielen Objekten aus der Arbeitswelt von damals. Letzteres zieht seit 2001 Scharen an Besucherinnen und Besuchern an und ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands. Auf 1700 Quadratmetern erschaffen die Brüder Gerrit und Frederik Braun mit ihrem Team Miniaturwelten von Venedig über die Alpen bis hin zu Hamburg selbst. Rund 1,5 Millionen Menschen besuchen jährlich die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Auch Hamburgerinnen und Hamburger kommen immer wieder, da die Miniaturwelt sich stetig wandelt und immer neue Orte dazukommen.
Seit 1991 steht die Speicherstadt unter Denkmalschutz, seit 2015 trägt sie den Titel UNESCO-Weltkulturerbe – eine späte Würdigung
Daneben füllen Ausstellungen, Restaurants und Büros die einstigen Lager. Seit 1991 steht die Speicherstadt unter Denkmalschutz, seit 2015 trägt sie den Titel UNESCO-Weltkulturerbe – eine späte Würdigung. Doch sollen große Teile der Speicherstadt ungenutzt bleiben? Immer wieder gab es Pläne, hier Wohnungen zu schaffen – als Erinnerung an die Tausenden, die einst vertrieben wurden und um weiteren attraktiven Wohnraum in der Stadt zu bieten. Doch die denkmalgeschützten Fassaden, begrenzten Flächen und hohe Kosten ließen die Idee scheitern. Auch der fehlende Hochwasserschutz macht Wohnraum unwahrscheinlich. Zum Arbeiten, Speisen, Flanieren und Fotografieren hingegen bleibt die Speicherstadt wohl für immer ein Hamburger Hotspot.