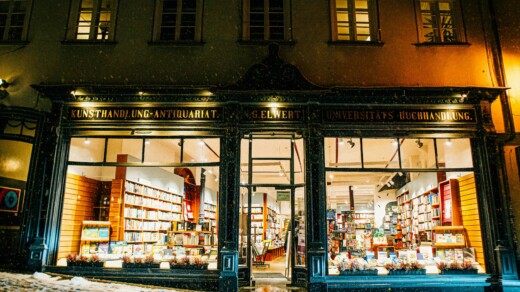SZENE HAMBURG: Anna, ihr seid als Clubkombinat ein Verband verschiedener Clubs. Wie kam es zur Idee für das Projekt „wtf – what the fear“?

Anna Lafrentz: Da wir uns mit „tba – to be aware“ für ein sicheres Nachtleben einsetzen, war es für uns der nächste logische Schritt, auch den öffentlichen Raum einzubeziehen. Ziel ist, dass alle Menschen an Live-Kultur teilhaben können, ohne Gewalt oder Diskriminierung erleben zu müssen.
Auf die Idee, ein Gewaltschutzprojekt auf der Reeperbahn zu starten, bin ich dann vor einiger Zeit auf einem Panel zum Thema Nachtleben gekommen. Dort hörte ich von einem Projekt in Bristol, in dem es um Sensibilisierung und Aufklärung für ein sicheres Feiern geht. Ich dachte mir: Das brauchen wir auf der Reeperbahn auch.
Das Projekt wird auf eurer Internetseite als Anlaufstelle für Informationen, Austausch und Selbstreflexion beschrieben. Was bedeutet das für euch?
Wichtig ist, dass wir offiziell keine Beratungsstelle für Betroffene sind, das können wir als Pilotprojekt nicht leisten. Unser Fokus liegt auf Sensibilisierung und Austausch über Gewalt und Diskriminierung im öffentlichen Raum. Dabei versuchen wir, möglichst niedrigschwellig viele Menschen zu erreichen.
Anna Lafrentz über die Arbeit von „wtf – what the fear“
Wie sieht diese Arbeit in der Praxis aus?
Das beginnt mit unserem 90-Meter-Banner am Bauzaun mit Illustrationen, die mögliche Reaktionen auf Ausgrenzung zeigen – ohne direkt gewaltvolle Situationen zu reproduzieren. Weitere Infos zu Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus oder Ableismus gibt es auf Plakaten an der Glasfront des Containers. Zu unseren Öffnungszeiten (Do–So, 17–23 Uhr) stehen zudem Mitarbeitende für Gespräche bereit. In diesen Gesprächen können Menschen ihre Erfahrungen auf der Reeperbahn teilen, sich über diese Themen austauschen und weiterbilden sowie Veränderungsvorschläge einbringen. Das hilft uns, die Probleme besser zu identifizieren und Lösungen zu suchen, die es braucht, um ein sicheres Feiern auf der Reeperbahn zu ermöglichen. Im Container und auf der Website gibt es zudem jede Menge Handlungsoptionen und Good Practices zu finden.
Alle unsere Mitarbeitenden haben Erfahrung in der Unterstützung von Betroffenen. Sie können bei akuten Problemen helfen und an passende Beratungsstellen weiterverweisen. Wir haben im Container für den Notfall auch einen Rückzugsraum geschaffen – für Personen, die in belastenden Situationen zur Ruhe kommen möchten. Außerdem ist unsere digitale Meldestelle sehr wichtig: Hier können Menschen ihre Erlebnisse oder Beobachtungen anonym mitteilen. Diese Rückmeldungen nutzen wir ebenfalls, um die Lage auf der Reeperbahn besser zu verstehen und daraus Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das Formular befindet sich auf unserer Internetseite.

Euer Projekt besteht aus einem gläsernen Container und einem 90-Meter-Bauzaun. Warum habt ihr diese Form gewählt?
Das hat sich spontan ergeben. Durch die Unterstützung von „Hanse Repair“ hatten wir die Möglichkeit, einen Container zu nutzen. Als wir diesen gläsernen Container gesehen haben, war schnell klar: Der passt perfekt zu unserem Projekt. Er steht für die Transparenz, die uns bei „wtf – what the fear“ besonders wichtig ist. Wir haben die Inhalte des Banners gemeinsam im Team ausgearbeitet – mit Unterstützung von Netzwerken und Beratungsstellen. Die Illustrationen sind von Julia Zeichenkind und bei der Gestaltung hat uns die Agentur Karl Anders unterstützt.
Vorwiegend positive Reaktionen auf das Projekt „wtf – what the fear“
Wie wurde das Projekt bisher von den Leuten auf dem Kiez angenommen?
Die Reaktionen waren sehr positiv. Wir haben mit einigen Menschen gesprochen, die sich sehr darüber gefreut haben, dass es jetzt einen solchen Ort auf der Reeperbahn gibt, der sich mit dem Thema Gewalt und Diskriminierung auseinandersetzt. Viele Menschen machen Fotos von unserem Banner am Bauzaun, das ist definitiv ein Hingucker. Die Leute kommen auch zum Container und fangen Gespräche mit uns an. Sie erzählen über ihre eigenen Erfahrungen oder stellen Fragen zu diesen Themen.
Natürlich gibt es vereinzelt auch Kritik. Als wir in der Umgebung Werbung für das Projekt gemacht haben, gab es einige, die das Problem nicht nachvollziehen konnten. Aber genau dafür ist „wtf“ da: um einen Raum für Dialog zu solchen Themen zu schaffen.
Von welchen Erfahrungen berichteten euch die Menschen?
Ein großes Thema ist sexualisierte Gewalt, also zum Beispiel Belästigung oder sexualisierte Angriffe. Aber die Menschen kommen auch mit zahlreichen anderen Erlebnissen zu uns. Häufig sind es Rassismus-Erfahrungen, zum Beispiel in der Clubschlange, Queerfeindlichkeit und auch Klassismus. Es kamen unter anderem einige wohnungslose Menschen zu uns, die von tätlichen Angriffen auf sie berichteten. Diese Menschen wurden teilweise verprügelt oder mit Gegenständen beworfen.
Langfristig wünsche ich mir eine feste Anlaufstelle für Betroffene.
Anna Lafrentz

Ihr steht jetzt seit über einem Monat auf dem Spielbudenplatz. Fällt dir ein konkretes Beispiel ein, in dem euer Projekt erfolgreich Sensibilisierung schaffen konnte?
Direkt fällt mir da der Austausch mit der Polizei in der Davidwache ein. In bisherigen Gesprächen hatte ich den Eindruck, dass ernsthaftes Interesse an anderen Perspektiven besteht.
Ansonsten erinnere ich mich an einige Gespräche mit Männern, die meist nur an Sexismus als Diskriminierungsform im Nachtleben dachten und sich selbst nicht als betroffen sahen. Im Verlauf der Unterhaltungen wurde ihnen dann bewusst, dass auch sie Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben. Vielen wurde außerdem erst durch diese Gespräche klar, dass es Menschen gibt, die sich gar nicht auf die Reeperbahn trauen.
Gibt es bereits Ideen für weitere Projekte oder Strategien auf der Reeperbahn?
Mein Ziel ist, dass „wtf“ in welcher Form auch immer auf St. Pauli bleibt. Langfristig wünsche ich mir eine feste Anlaufstelle für Betroffene. Wir überlegen, die digitale Meldestelle zudem auch nach dem Umsetzungszeitraum am Spielbudenplatz weiterlaufen zu lassen.
Zusätzlich sind wir seit Beginn des Projekts mit den Behörden und weiteren Stadtakteur:innen im Gespräch. Mit den Ergebnissen aus der Pilotphase wollen wir erste strategische und ganzheitliche Überlegungen anstellen und idealerweise konkrete Schutzmaßnahmen unter anderem in Stadtentwicklungsprozesse integrieren.
Neueste Entwicklung: Der Container kommt am 17. – 20. September für das Reeperbahn-Festival zurück auf den Spielbudenplatz. Zudem bleibt die Seite wtf-stpauli.org weiterhin bestehen. Sie beinhaltet die digitale Meldestelle sowie weitere Informationen und Material zu dem Thema.