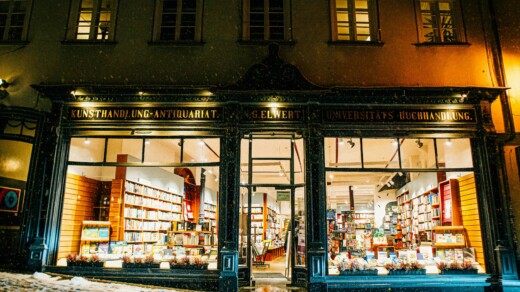SZENE HAMBURG: Wann und wie bist du auf die Idee zur Geschichte von „Striker“ gekommen?
Helene Hegemann: Das sind grundsätzlich immer erst mal Stimmungen und schwer zu benennende Gefühle, die einem zu widersprüchlich vorkommen, um sie zu benennen. Manchmal braucht man einen ganzen Roman, um sich ihnen zu nähern.
Und was war das konkret bei „Striker“?
Ich habe in Berlin am Schlesischen Tor gewohnt, wo das Buch in gewisser Weise auch spielt – direkt am Ufer, in vergleichbaren Verhältnissen zu denen, die im Buch geschildert werden: ganz oben, freie Sicht auf eine Brandmauer. Und tatsächlich waren da eines Morgens diese Zeichen von Paradox, dem Vorbild für Striker, mit vertikal heruntergesprühten Zeichen. Das war ein intuitiver Moment von: Hier verdichtet sich gerade was. Das hat ein Potenzial für eine Geschichte, in der ich diverse ungeordnete Empfindungen umkreisen kann.
Spürst du dann sofort, dass das jetzt ein Romanthema ist oder verwirfst du solche Eingebungen auch immer mal wieder?
Ich habe immerhin ein okayes Gespür dafür, ob mich ein Thema wachsen lässt. Und darum geht es ja häufig: um Bewegung. Um ein Wachstum, im Sinne von Vertiefung, nicht im Sinne von Vergrößerung. Solche Eingebungen sind aber in der Tat selten.
Helene Hegemann über Schreibprozesse
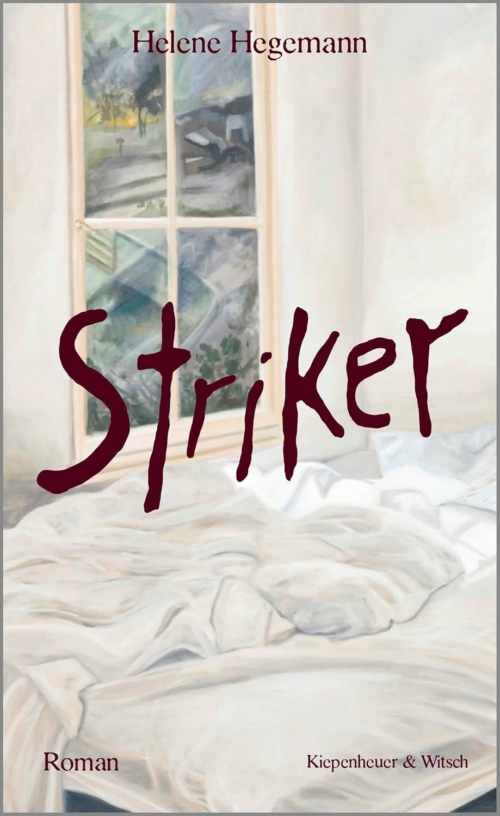
Wenn die Gegend bei dir anfangs im Zentrum stand, wann kamen dann die Figuren in die Geschichte rein?
Ich habe bereits mit dem Begriff der Figur ein großes Problem, weil ich Figuren in Büchern immer für Energien innerhalb deiner selbst halte, die du versuchst, auf Charaktere aufzuteilen. Figuren konstruieren, das hat mich nie interessiert, die sind halt entweder da oder nicht.
Aber es ist doch auch konstruiert; muss konstruiert sein, damit man es in einen Roman packen kann, oder?
Ich versuche immer, die Intuition vor die Konstruktion zu stellen. Aber bei meiner Hauptfigur war klar, dass sie körperlich hart arbeiten muss, um eine prekäre Existenz aufrechterhalten zu können; und dass ihr Ziel etwas ist, das unter keinen Umständen eine erhoffte Erlösung bringen wird, weder finanziell noch seelisch. Das hat mich sehr interessiert: Diese Höchstleistung in einem Bereich, in dem man keinen offiziell messbaren Erfolg haben kann; in dem sich der Erfolg nicht auszahlen wird und in dem man herausfinden muss, worin Erfolg jenseits von Geld und Ruhm bestehen kann. Was für eine Art Kampf das ist. Die war übrigens zuerst Tänzerin – hat sehr viel schlechter funktioniert.
Warum?
Weil es sofort einen elitären Anstrich hatte. Und: Man kann übers Tanzen schlecht schreiben. Es hat einen Grund, dass sich viele Schriftsteller im Laufe der Jahrzehnte eher fürs Boxen als für Ballett interessiert haben. Denn beim Tanzen wird dir die Geschichte schon abgenommen. Über Tanz schreiben ist ähnlich wie über Musik schreiben: Das wird obsolet, wenn du versuchst, dem verbal gerecht zu werden.
Aber über Musik schreiben ja sehr viele Leute.
Aber auch gut, findest du? Hast du schon mal einen richtig guten Roman über ein Album gelesen?
Musik über Literatur?
Ich finde es zumindest sehr beeindruckend, wenn es jemand schafft, Musik zu verbalisieren; wenn jemand die richtigen Worte findet für das Gefühl, das ein Musikstück einem vermittelt.
Wenn das gelingt, ist das großartig, aber ich erlebe das nicht oft. Ich würde auch immer sagen: Musik gewinnt gegen Literatur. Jederzeit. Ich würde aber auch sagen, eine dreiminütige Boxrunde gewinnt jederzeit gegen einen Roman – weil es immer die interessantere Geschichte ist.
Du selbst bist ja auch schon lange Kampfsportlerin und machst MMA.
Echt nicht exzessiv, aber aus Interesse an der Sache. Seit sieben Jahren.
Wie bist du dazu gekommen?
Als Teenager habe ich getanzt, damit aufgehört, jahrelang nach einer Alternative gesucht. Interessanterweise kam mir Kampfsport immer am nahe liegendsten vor, weil es keine Konkurrenz dazu bedeutet, der Körper gleichzeitig aber ähnlich involviert ist. Tanzen und Kämpfen, das hat einerseits gar nichts, andererseits sehr viel miteinander zu tun.
Über Kampfsport und Protagonisten: Striker
Was interessiert dich am Kampfsport vor allem?
Sagen wir so: Ich halte Kampfsport insofern für eine interessante Kulturtechnik, als sich Leute zwar in die Fresse schlagen, aber unter Einverständnis beider Seiten zu einem vereinbarten Zeitpunkt. Und dann wird auf Kommando auch sofort wieder damit aufgehört, bestenfalls liegen sich die Kontrahenten danach sogar in den Armen. Ich kenne keinen anderen Bereich im menschlichen Leben, der diese Extreme so übergangslos miteinander verbindet. Das finde ich erst mal erforschenswert.
Dein Schreibstil ist generell sehr geprägt von Dualität, von dem Aufgreifen von Gegensätzlichkeiten – auch bei „Striker“. Warum ist das so?
Das ist der Kern von allem, was ich mache. In der Hoffnung, dass in der Fusion von Widersprüchen eine Wahrhaftigkeit zum Vorschein kommt, die man nicht in 140 Zeichen untergebracht kriegt.
Die Protagonistin aus „Striker“ trägt keinen Namen, sondern heißt einfach N. Warum?
Ich weiß es nicht. Die simpelste Erklärung wäre, das vom Namen in ein paar Jahren eh nur der Anfangsbuchstabe übrig bleibt; von diesen Kämpferinnen, die bei Amateurkämpfen antreten. Da gibt es ja gar kein Potenzial, sich – im wahrsten Sinne des Wortes – einen Namen zu machen. Das war der Gedanke. Aber N. befindet sich eben auch in einem Selbstauflösungsprozess, bei dem das Erste, was draufgeht, wahrscheinlich der eigene Name ist. Rückblickend kann ich das jetzt als Erklärung dazuliefern, beim Schreiben war das reine Intuition. Die hätte einfach nicht Annika heißen können. Ich hätte es fast als Affront empfunden, der einen Vornamen hinzuknallen.
Letzte Sätze
Wie wichtig sind dir die ersten und letzten Sätze eines Romans? Bei „Striker“ ist der erste Satz „Ist die Jahreszeit wichtig?“ und der letzte lautet: „Es ist zu kalt draußen.“
Diese Rahmung wird mir jetzt zum ersten Mal bewusst, interessant. Es macht auf jeden Fall Spaß, nach berühmten ersten Sätzen zu googeln, oder?
Ja, total. Aber ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen: Dein erster Satz aus „Striker“ hat mich nicht direkt mit offenen Augen dastehen lassen.
Ich finde ja: Wenn erste Sätze auslösen, dass man mit offenen Augen dasteht, sind sie nicht gut. Im besten Fall fassen sie das ganze Buch zusammen, ohne dass man es mitkriegt. Fragen sind auch nicht schlecht. Und worum ich mich immer bemühe, ist ein Einreißen der Ebenen; darum, klarzumachen, dass jemand erzählt, der auch außerhalb der Geschichte funktioniert – also eine Position zu finden zwischen auktorialem Erzählen und Ich-Perspektive, die nicht so leicht einzugrenzen oder auszuklammern ist. „Ist die Jahreszeit wichtig?“ ist ganz konkret eine Frage der Autorin, die am Schreibtisch sitzt und überlegt, ob es essenziell ist, zu thematisieren, dass sich das Ganze im November abspielt.
Welcher Satz ist dir wichtiger: Der erste oder der letzte?
Bei „Striker“ habe ich den letzten Satz auf jeden Fall öfter geändert als den ersten.
Ach ja? Wie lautete er noch?
„Es ist zu kalt draußen“, aber er lautete auch mal „Es ist eiskalt draußen“, „Es ist arschkalt draußen“ und auch ganz schlicht nur „Es ist kalt draußen“. Aber „Es ist zu kalt draußen“ kommt der Wahrheit am nächsten.
Dieses Interview ist zuerst in SZENE HAMBURG 04/2025 erschienen.