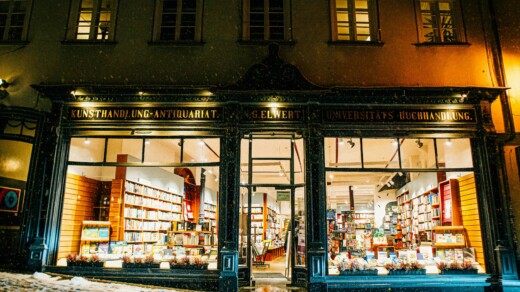Machen wir uns nichts vor: Im Zeitalter sozialer Medien und künstlicher Intelligenzen haben sich unsere Wahrnehmungsmaßstäbe verändert. Wir können Bildern nicht länger trauen – zu einfach und überzeugend können sie uns falsche Wirklichkeiten vorspiegeln. Oder hat sich an unserem Verhältnis zu visuellen Medien im Laufe der Jahrhunderte doch gar nicht so viel verändert, weil es immer schon von dem Zwiespalt geprägt war, dass Bilder die Wirklichkeit nicht zwangsläufig abbilden, sondern auch aktiv gestalten können? Dieser Frage geht aktuell die Kunsthalle in ihrer großen Ausstellung „Illusion“ nach – und blickt dabei tief in die Trickkiste der Kunstgeschichte.
Rund 150 Werke – ebenso von alten Meistern wie zeitgenössischen Größen – machen hier in zehn verschiedenen Themenkapiteln deutlich, dass Illusionskunst zwar meist zum Ziel hat, Fakt und Fiktion zu vermengen, doch ihre Entstehungskontexte und Ausdrucksformen sehr verschieden sein können. So wird im ersten Raum die ganze Klaviatur der Träume bedient: Neben religiösen Visionen bringt Caspar David Friedrich die personifizierte künstlerische Eingebung und damit die lichte Seite der Romantik auf die Leinwand, während Francisco de Goya mit albtraumhaften Szenen aufwartet. In unmittelbarer Nachbarschaft reflektieren verschiedene Objekte diverse Spiegelphänomene. In Anish Kapoors konvex-konkaver Kugel von 2019 etwa können sich die Besucher spielerisch selbst entdecken und hoffen, dass es ihnen nicht so ergeht wie Narziss auf John William Waterhouses großformatigem Gemälde von 1903. Dem antiken Mythos nach verliebte sich der Jüngling heillos in sein Abbild auf der glänzenden Wasseroberfläche – und ging daran zugrunde.
Der Vorhang als Symbol der Täuschung in der Illusion-Ausstellung
Im Hauptausstellungsraum kehrt vor allem ein Motiv wieder, hinter dem sich verschiedene kunsthistorische Themenfelder verbergen: der Vorhang. Mal initiiert er ein reizvolles Spiel zwischen Verhüllen und Enthüllen, mal vermittelt er zwischen zwei Räumen oder Realitätsebenen, wie bei Nan Goldings Foto eines Hotelzimmers mit Fensterblick. Gerhard Richters gemalter Vorhang wiederum, der eine riesige Leinwand ausfüllt, referiert auf den antiken Ursprungsmythos des künstlerischen Illusionsgenies schlechthin: Parrhasius, der in der Lage gewesen sein soll, selbst seinen größten Malerkonkurrenten Zeuxis auf das Peinlichste zu täuschen. Der Erzählung nach musste Zeuxis auf seinen Versuch hin, den Vorhang über Parrhasius’ Gemälde zu lüften, schmerzlich feststellen, dass der Stoff nicht über dem Bild hing, sondern selbst das Bild war.
Maximale Sinnestäuschung steht auch im Zentrum des Trompe-l’oeil, einem besonders im 17. Jahrhundert beliebten Genre, das seine Bildgegenstände extrem plastisch und lebensnah zeigt. Auch heute noch reihen sich Künstler in diese Tradition ein, wie etwa Ron Mueck, von dem in der Kunsthalle ein übergroßes, hyperrealistisches Rebhuhn von der Decke baumelt – und zwar direkt neben einem barocken Gemälde von Jan Baptist Weenix mit dem gleichen Motiv.
Illusion durch eine KI-Installation
Doch ganz ohne Arbeiten, die aktuelle Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz kommentieren, entlässt die Schau ihre Besucher nicht. So führt der Rundgang am Ende in ein dunkles Kabinett, in dem Andreas Greiner mit seiner Installation „Conspiracy Theory“ eine Art Verhörsituation mit einer KI inszeniert hat. Letztlich liegt der Schwerpunkt der Ausstellung aber darauf, die vielfältigen Formen sowie thematischen Kontinuitäten von Illusionskunst über die Jahrhunderte und Gattungsgrenzen hinweg aufzuzeigen. Und das ist gut so: Denn hierin bestätigt sich nicht nur der anfängliche Verdacht, dass eine gesunde Skepsis gegenüber dem Wirklichkeitspotenzial visueller Medien immer schon Teil kritischer Bildbetrachtung war. Sondern vor allem tritt eine beruhigende Gewissheit zutage: Die Kunst bietet uns noch immer einen Spiel- und Schutzraum, in dem wir Täuschung aus freien Stücken und sogar mit Genuss zulassen können.
Dieser Artikel ist zuerst in SZENE HAMBURG 03/2025 erschienen.