Die Romanautorin Karen Köhler erzählt in „Miroloi“ von einer jungen Frau, die sich einem autoritären System widersetzt. Ein Gespräch über die politische Weltlage, die Macht der Bildung und über die Notwendigkeit des Aufbegehrens
Interview: Ulrich Thiele
Foto: Christian Rothe
Vor fünf Jahren löste Karen Köhler mit ihrem Erzählband „Wir haben Raketen geangelt“ ein – ohne Übertreibung – kollektives Entzücken im Feuilleton aus. Gelobt und geliebt wurden ihre modern und zugleich altmodisch anmutenden Geschichten vor allem für ihren radikal eigenen Sprachstil und für ihre eindrucksvollen Frauenfiguren. Dem entsprechend heiß wird nun ihr Debütroman „Miroloi“ erwartet, der am 18. August im Hanser Verlag erschien.
Karen Köhler lebt auf St. Pauli, wo das Interview an einem Dienstagvormittag draußen vor einem Café stattfindet. Es ist ein ausführliches Gespräch von anderthalb Stunden, mit Exkursen über die politischen Entwicklungen der letzten vier Jahre, die nicht am Entstehungsprozess von „Miroloi“ vorbeigegangen sind, wie sie sagt.
SZENE HAMBURG: Karen, wann hast du das letzte Mal aufbegehrt?
Karen Köhler: Gerade Sonntag habe ich mit der Seebrücke Hamburg gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung demonstriert. Auf die Straße zu gehen und Gesicht zu zeigen, ist definitiv ein Akt des Aufbegehrens. Aber man kann auch in den kleinsten Augenblicken aufbegehren. Es ist in Deutschland sehr viel durch Gesetze geregelt, das soll unser Zusammenleben wohl einfacher machen, manchmal hält es aber auch vom Denken und Selbst entscheiden ab, oder entfernt sich wie im Falle der Kriminalisierung der Seenotrettung von dem demokratischen Wertekanon, auf den man sich in Europa mal geeinigt hat.
„Die Welt verändert sich schneller, als ich sie erfassen kann“
In „Miroloi“ begehrt eine junge Frau auf gegen die autoritären Strukturen in einem isolierten, archaischen Dorf auf einer Insel. Männer haben das Sagen, Frauen dürfen nicht lesen, es gibt Traditionen, religiöse Gesetze und drakonische Strafen. Es gibt auch einige Verweise auf die Gegenwart jenseits der Insel: Coca Cola und Fernseher zum Beispiel. Warum dieses Archaische im Modernen?
Anfang 2015 hatte ich zunehmend Schwierigkeiten, die Welt zu beschreiben. Sie verändert sich schneller, als ich sie erfassen kann. Deswegen habe ich diesen Mikrokosmos einer fiktiven Insel erfunden, den ich auf strukturelle Mechanismen untersuchen konnte: Wie ist eine Gesellschaft organisiert? Wie viele Gesetze braucht sie? Wie begegnet sie dem Fremden, was macht das Fremde mit ihr? Wie gehen Machthaber mit ihrer Macht um? Gerade Macht übt eine Faszination auf Menschen aus. Wer sie hat, wird in Versuchung geführt, sie auch zu demonstrieren.
Wie hast du recherchiert, um diese Welt zu entwerfen? Du erfindest ja so gar eine Religion.
Ich habe vier Monate auf einer Insel in Griechenland verbracht und dort existente Dorftraditionen kennengelernt. Das Wort „Miroloi“ zum Beispiel kommt aus dem Griechischen und beschreibt eine Totenklage. Es gibt in mehreren Regionen Griechenlands die Tradition, dass die Dorfältesten nach dem Ableben eines Menschen sein gesamtes Leben nachsingen.
Ich habe zudem gemeinsam mit zwei Dolmetschern die Dorfbewohner interviewt, was viel mit Vertrauen zu tun hatte. Es dauert, bis Menschen an den Punkt kommen, an dem sie bereit sind, über Schmerz zu sprechen.
Hast du ein Beispiel?
Wir haben mit einem alten Bauern gesprochen und saßen in seinem Haus in einem Dorf, in dem der Strom nie angekommen ist und das deswegen verlassen wurde. Er ist aber immer noch jeden Tag dort in diesem Haus, das sein Vater mit eigenen Händen gebaut hat. Auf die Frage, was er sich wünschen würde, wenn er einen Wunsch frei hätte, sagte er, dass er gerne alle seine Nutztiere noch mal sehen würde. Diese Unmittelbarkeit hat mich unfassbar berührt, dieses dem Leben und Überleben ausgesetzt zu sein. Davon sind wir in unserer urbanen Alltagswelt auf den ersten Blick sehr weit entfernt.
Warum nur auf den ersten Blick?
Wir sind dennoch Nutznießer dessen – wir konsumieren jeden Tag das, was Leute irgendwo in der Welt angebaut haben. Die Menschen, die in Spanien auf den Feldern unsere Tomaten ernten, sind oftmals geflüchtete Menschen aus Afrika, die unter den schlimmsten Bedingungen leben. Und die Menschen, die Tiere auf niedersächsischen Schlachthöfen schlachten, kommen aus Rumänien und hausen unter unwirtlichen Bedingungen. Wir sind bei genauerer Betrachtung gar nicht so weit weg von den archaischen Verhältnissen, die im Buch beschrieben werden.
Warum hast du im Buch das Dorf mit diesem repressiven Gesellschaftsmodell entworfen?
Ich habe mich gefragt, wie die Unterdrückung der Frau strukturiert ist – indem man sie von Bildung fernhält und an Haus und Kind bindet. Anfang des Jahres habe ich ein Interview mit einem spanischen Priester zum Thema häusliche Gewalt gelesen. Er sagte, Frauen seien selbst schuld, wenn sie geschlagen werden, sie hätten ihren Männern einfach nicht gut genug gedient. Das ist in Europa im Jahr 2019. So lange es dieses Gedankengut noch gibt, kann man nicht aufhören, solche Bücher da rüber zu schreiben.
Die Protagonistin in „Miroloi“, die am Anfang noch keinen Namen hat, erfährt diese Unterdrückung sehr extrem.
Sie ist ein Findelkind. Die Gesetze im Dorf schreiben aber vor, dass jeder nach der Mutter oder nach dem Vater benannt wird. Nur wer diesen Stammnamen hat, darf partizipieren. Die Ungewissheit, woher sie kommt, verängstigt die Dorfbewohner. Sie erhält deswegen keinen Namen und damit fängt die Kette der Ausgrenzung an. Ihr wird die Rolle des Sündenbocks zugeschrieben.
In dem Winter, in dem sie gefunden wurde, gab es Frost, der die Ernte zerstört hat. Das Dorf, das in seiner Aufklärung nicht fortgeschritten ist, gibt ihr dafür die Schuld. Dieses Narrativ begleitet dieses junge Mädchen von Anfang an. Wenn sie nicht in einem religiösen Oberhaupt, dem Bethaus Vater, einen Fürsprecher hätte, der sie schützt, hätte sie die ersten Jahre wohl nicht überstanden.
Der Bethaus Vater erkennt in ihr den Menschen, wie er in jeder Person den Menschen erkennt. Unter diesem Schutz wächst sie bei ihm auf und gerät irgendwann an einen Punkt, wo sie anfängt, das System zu hinterfragen. Das zwirbelt sich auch an ihrem Namen auf: Warum hat alles einen Namen, nur ich nicht?
Ein großer Gesang auf die Selbst-Ermächtigung
Da ist ein Riss in ihrem Gehorsam, sagt sie an einer Stelle. Fängt mit dem Riss ihr Leben, ihr Miroloi erst an?
Ja, das kann man so sagen. In meinen Augen ist das ein großer Gesang auf die Selbstermächtigung. Sie lernt heimlich lesen und schreiben und verschafft sich somit Zugang zu Bildung und einen Abstand zur Welt. Sie lernt, sich ins Verhältnis zu setzen und die Dinge zu hinterfragen, und schafft so den Sprung aus dem rein emotionalen Welterleben in eine Abstraktion. Die Stelle, in der sie lernt, was der Konjunktiv ist, ist programmatisch für dieses In-Distanz-treten.
Auf der anderen Seite beschreibt sie die Welt, die sie sieht und erlebt, mit Sinneslust und Entdeckungsfreude, als könne sie die Welt erst jetzt mit der Sprache so richtig greifen.
Sie ist definitiv ein sehr lebenshungriger Mensch und hat eine große Offenheit für alles, was sie wahrnimmt. Sie erfindet auch Worte: „Das Haus liegt hier am Berg. Engschattig und drübensicher.“ „Drübensicher“, also sicher vor dem Fremden auf der anderen Seite des Meeres, ist so ein typisches Wort für sie. Sie hat ihren eigenen Zugang zur Welt, wie ein durch tausend Kanäle gehendes System.
Der Bethaus-Vater scheint eine moralische Autorität zu sein. Es gibt aber auch Momente, die diesen Eindruck zum Bröckeln bringen. Zum Beispiel, wenn die Protagonistin ihre Angst beschreibt, dass er wieder einen Wutausbruch kriegen könnte.
Ich wollte eine Figur im Buch haben, die ambivalent ist. Niemand, auch ein religiöses Oberhaupt nicht, ist gefeit vor emotionaler Entrückung, Wut oder Lust. Der Bethaus-Vater ist sehr lebemännisch, er trinkt und isst gerne. Und er partizipiert an einem System, von dem er weiß, dass es nicht fair ist. Er hat genauso Angst vor einem Machtverlust wie alle anderen. Trotzdem versucht er nach seinem besten Wissen und Gewissen das Dorf auf einer religiösen Ebene zu leiten.
Aber er unterläuft das System auch subversiv von innen, etwa dann, wenn er der Protagonistin das Lesen beibringt.
Genau. Es gibt eine Strophe, in der die Protagonistin alles aufzählt, was sie vom Bethaus-Vater gelernt hat. Dazu gehört auch, „wie man das Gesetz biegt, ohne es zu brechen“. Er sucht die Lücken im System. Er hat einen parallelen Subwoofer von eigener Moral am Laufen, nach der er abwägt, welche Gesetze er übersehen und umgehen kann.
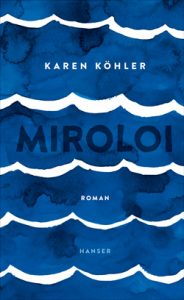 Ist der Roman optimistisch? Dass sie ihr eigenes Miroloi singt, kann man auch so verstehen, dass sie stirbt.
Ist der Roman optimistisch? Dass sie ihr eigenes Miroloi singt, kann man auch so verstehen, dass sie stirbt.
Auf der einen Seite ist es ein wahnsinnig optimistisches Buch, weil sie sich selbst ermächtigt und den Weg in die Freiheit geht. Sie hat den Mut, sich zu wider setzen und riskiert ihr eigenes Wohlergehen. Das Ende habe ich bewusst offen gelassen, ob es pessimistisch oder optimistisch ist – das kann jeder für sich entscheiden.
Karen Köhler: „Miroloi“, Hanser, 464 Seiten, 24 Euro. Der Roman ist am 18.8. erschienen. Am 16.9.2019 liest die Autorin im Rahmen des HarbourFront Literaturfestivals im Nochtspeicher.
 Dieser Text stammt aus SZENE HAMBURG, August 2019. Titelthema: Wie sozial ist Hamburg? Das Magazin ist seit dem 27. Juli 2019 im Handel und zeitlos im Online Shop oder als ePaper erhältlich!
Dieser Text stammt aus SZENE HAMBURG, August 2019. Titelthema: Wie sozial ist Hamburg? Das Magazin ist seit dem 27. Juli 2019 im Handel und zeitlos im Online Shop oder als ePaper erhältlich!

