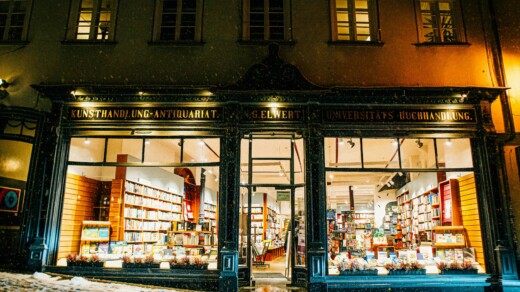SZENE HAMBURG: Das Thema Nachhaltigkeit durchdringt unseren Alltag auf vielen Ebenen – und hat dadurch oft auch ein ungeahntes Bedeutungs- und Formenspektrum. Was kann man sich unter nachhaltiger Arbeit speziell im Kontext Museum vorstellen?
Alexander Stockinger: Meist wird Nachhaltigkeit unter drei Gesichtspunkten betrachtet: unter ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen. Alle drei Aspekte bezieht auch das MK&G in seine Arbeit ein. In den letzten Jahren ist im Haus schon einiges im sozialen Bereich passiert – gerade, was Inklusion, Diversität und Barrierefreiheit angeht. In jüngerer Zeit haben wir uns verstärkt der ökologischen Seite gewidmet. Grundsätzlich ist aber bei allen drei Punkten wichtig, dass man nach außen und nach innen am Thema arbeitet.
Das heißt?
Stockinger: Zum einen meine ich damit unser Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm, das die Öffentlichkeit direkt adressiert. So hatten wir seit 2010 etwa im Zweijahresrhythmus Ausstellungen zum Plastikmüll im Meer, zur Fast Fashion, zur Ernährung der Zukunft, zum ökologischen Fußabdruck der Fotografie oder zur globalen Wasserkrise. Als Museum für Gestaltungsfragen stehen wir auch in der Verantwortung, die Gestaltung unserer Welt aktiv in den Blick zu nehmen – und daran mitzuwirken. Zum anderen ist Nachhaltigkeit auch für innerbetriebliche Entwicklungen sehr wichtig, ob es nun um Abfallentsorgungsstrategien, Energieeffizienz oder inhaltliche Schulungen unseres Teams geht. Wir können nur glaubwürdig über Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir auch selbst in unserem Betrieb nachhaltig werden.
Nachhaltigkeit im Museum für Kunst und Gewerbe
Können Sie zu den innerbetrieblichen Entwicklungen auch noch Beispiele geben?

Stockinger: Technisch und infrastrukturell haben wir schon einiges verändert. Im Prinzip ist das Museum mittlerweile vom Dach bis in den Keller auf LED-Beleuchtung umgestellt. Zudem wird das Haus von einem smarten Energiemanagement-System vorausschauend gesteuert, das regelmäßig aktuelle Wetterdaten abruft. Bei den Ausstellungsproduktionen wiederum schonen wir Ressourcen, indem wir etwa das Mobiliar nachnutzen. Und wir kümmern uns auch um unseren digitalen Fußabdruck, arbeiten datensparsam und reduzieren Servervolumen, um weniger CO2 zu produzieren.
Sie sind eines der größten Häuser in Hamburg mit eigener Sammlung. Wie sieht denn nachhaltiges Sammeln aus?
Stockinger: Seit ihren Gründungen sind die meisten Museen kontinuierlich gewachsen – so auch das MK&G, und zwar seit 1877. Lange Zeit hielt sich die Idee, man könne immer weiterwachsen. Viele Einrichtungen haben mittlerweile aber Platzprobleme und müssen dadurch ihre Sammlungsstrategie verändern. Tulga Beyerle, unsere Direktorin, hat im MK&G schon viel angeschoben – und mit den Leitungen unserer Sammlungsbereiche klare Leitlinien geschaffen, was künftig ins Museum kommen soll. Vor allem schaffen wir Objekte dort neu an, wo wir noch historische oder gattungsbezogene Lücken sehen. Aber man wird auch über die Grenzen des Sammelns sprechen müssen. Und auch die baulichen Standards von Depots müssen überdacht werden. Da geht der Trend eher zu Low-Tech. Lehm ist beispielsweise ein attraktiver Baustoff, weil damit Schwankungen der Luftfeuchte abgemildert werden – das spart Klimatisierung und macht auch unter wirtschaftlichen Aspekten Sinn.
Die Initiative „Elf zu Null“ will die Museumsarbeit nachhaltiger gestalten
Lassen Sie uns noch über „Elf zu Null“ sprechen, eine wichtige Initiative, bei der elf Hamburger Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten seit 2022 gemeinsam daran arbeiten, Museumsarbeit nachhaltiger zu gestalten. Was sind die Ziele?

Caroline Markiewicz: Einmal geht es uns darum, dass die beteiligten Häuser beim Erreichen der Hamburger Klimaziele mitwirken: Hier sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 70 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 reduziert und bis 2045 eine Netto-CO2-Neutralität erreicht werden. Zugleich versuchen wir aber auch den gesamtgesellschaftlichen Weg Richtung mehr Nachhaltigkeit aktiv mitzugestalten und unsere Besucherinnen und Besucher ebenso zu sensibilisieren wie unser eigenes Team.
Das MK&G ist bei der Initiative federführend. Wie läuft die gemeinsame Arbeit mit den anderen Häusern ab?
Markiewicz: Alexander leitet das Projekt und ich koordiniere den Austausch innerhalb des Netzwerks. Es gibt gemeinsame Maßnahmen, an denen die Häuser jeweils im Kontext ihrer Möglichkeiten arbeiten. Für die Umsetzung der Maßnahmen haben wir zu Beginn des Projekts sogenannte Transformationsmanagerinnen und -manager ausgebildet, die dann wiederum alle Fortschritte und Erkenntnisse aus den einzelnen Museen ins Netzwerk zurückspielen, damit wir voneinander lernen können und auch die häuserübergreifenden Maßnahmen weiterentwickeln können. Stockinger: Im Prinzip ist „Elf zu Null“ ein Rahmen dafür, Kompetenz aufzubauen und Wissen zu vernetzen, um gemeinsam aktiv zu werden. Museen dürfen einfach nicht auf einer Bekenntnisebene verharren. Wer behauptet, das Thema Nachhaltigkeit sei zu groß, sucht nach einer Ausrede. Markiewic: Das stimmt: Wir müssen handeln – und zwar jetzt.
Bisherige Maßnahmen des Museums für Kunst und Gewerbe
Was ist denn schon alles passiert, häuserübergreifend und im MK&G?
Stockinger: Zuerst haben wir 20 Leute ausgebildet und wir erstellen jährlich unsere Klimabilanzen. Letztes Jahr haben wir unsere ersten gemeinschaftlichen Richtlinien verabschiedet zum Thema Abfallmanagement und auch eine nachhaltige Dienstreisepolitik verfasst, die im Zeichen der CO2-Reduktion steht. Markiewicz: Zudem hat jedes Haus auch individuelle Projekte. Bei uns ist eines davon die „Grüne Spur“ – mit dem Ziel, in den Ausstellungsräumen betriebliche Nachhaltigkeitsprozesse sichtbar zu machen. Transparente Kommunikation nach außen ist uns sehr wichtig. Stockinger: Zum Beispiel kann man sich Hinweisschilder vorstellen, auf denen so etwas steht wie: Schauen Sie mal nach oben, das ist eine von 2800 LED-Lampen, die wir im letzten Jahr installiert haben.
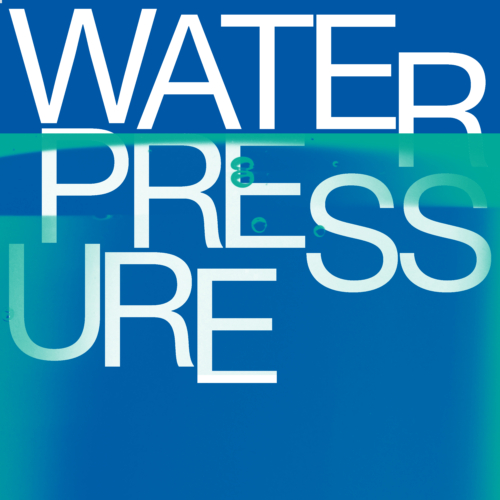
Was sind die nächsten Schritte im MK&G, um noch nachhaltiger zu werden?
Stockinger: Aktuell schieben wir gerade die nächsten Projekte an: Da geht es neben der Nachnutzung von Ausstellungsmobiliar auch um die Mobilität der Gäste oder bauliche Aspekte, unter denen wir künftig selbst Energie erzeugen können. Nachdem wir viel Veränderung in Verwaltung und Technik angestoßen haben, kommen jetzt neue Expertisen hinzu – durch Personen aus der Wissenschaft und Vermittlung. Wie sich das Thema Nachhaltigkeit bei uns strukturell ausbreitet, ist wirklich schön zu sehen. Markiewicz: Zudem starten wir gerade die zweite Ausbildungsrunde im Transformationsmanagement. Unser Plan, eine Zukunftsperspektive über das konkrete Handeln zu entwickeln, bleibt. Wir wollen uns weiterhin von der Frage leiten lassen: Was können wir jetzt, in diesem Moment, tun? Um dann genau dort anzusetzen.
Dieses Interview ist in SZENE HAMBURG 04/2025 erschienen.