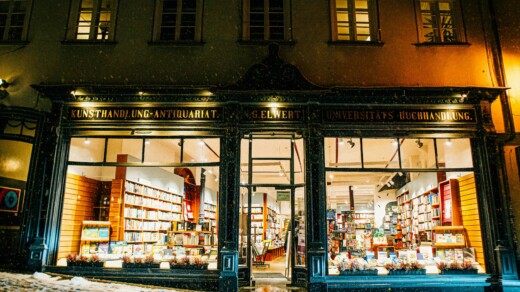In der ehemals evangelisch-lutherischen Bugenhagenkirche in Barmbek findet die Schwarze Community ein Zuhause, in dem sie ihr Leben neu erfinden kann. Auf 2556 Quadratmetern werden in zahlreichen „Spaces“ gesellschaftliche, politische, kulturelle und afrikaspezifische Fragen diskutiert und Lösungsstrategien entwickelt. Ein Gespräch über innovative Schwarze Perspektiven.
SZENE HAMBURG: Dr. Christian Ayivi, Afrotopia ist die erste Denk- und Kulturfabrik der Schwarzen Community in Hamburg. Schwarzes Leben ist bunt und heterogen. Was macht es zur Community?
Dr. Christian Ayivi: Genau diese Vielfalt macht uns als Community aus. Schwarzes Leben in Hamburg und in Deutschland ist durch sehr unterschiedliche Geschichten, Migrationserfahrungen, Generationen und kulturelle Bezüge geprägt. Was uns verbindet, ist das gemeinsame Bewusstsein, dass wir Teil einer Schwarzen Geschichte und Gegenwart in Deutschland sind – mit all ihren Herausforderungen, aber auch mit ihrer Kreativität und Stärke. Zur Community wird dieses bunte Mosaik, weil wir Räume schaffen, in denen wir uns gegenseitig sehen, zuhören und unterstützen können. Afrotopia ist so ein Raum: ein Ort, an dem Unterschiede nicht trennen, sondern bereichern, und wo wir unsere Stimmen bündeln können, um sichtbar zu sein und gemeinsam gesellschaftliche Impulse zu setzen. Unsere Community entsteht also nicht durch Gleichförmigkeit, sondern durch Solidarität, geteilte Erfahrungen von Rassismus und Widerstand – und durch die Freude daran, unsere Vielstimmigkeit zusammenzubringen.
Die Motivation kam vor allem aus der Feststellung, dass in Hamburg kein Raum vorhanden war, der Schwarze Perspektiven konsequent ins Zentrum stellt, in dem wir uns nicht nur über Rassismus definieren, sondern unsere ganze Vielfalt, Kreativität und Geschichte leben können.
Dr. Christian Ayivi
Sind auch nicht-schwarze Menschen willkommen?
Afrotopia versteht sich als Raum, der von der Schwarzen Community getragen wird und ihre Perspektiven ins Zentrum stellt. Aber unsere Arbeit lebt vom Dialog und davon, Brücken zu bauen. Wer mit Respekt, Offenheit und der Bereitschaft kommt, zuzuhören und zu lernen, ist Teil dieses Miteinanders. Ziel ist einen gesellschaftlichen Zusammenhalt mit allen Gruppen und Schichten der Gesellschaft zu erreichen. Es geht nicht darum, Grenzen zu ziehen, sondern darum, einen sicheren Ort zu schaffen, in dem Schwarze Erfahrungen sichtbar und ernst genommen werden.
Sie sind studierter Theologe und Germanist, haben lange in der Informationstechnologie gearbeitet. Was hat Sie motiviert, Afrotopia zu gründen?
Für mich war Afrotopia eine Herzensentscheidung. Als Theologe denke ich über Sinn, Gemeinschaft und Werte nach. Als Sprachwissenschaftler kenne ich die Bedeutung von Sprache und Kultur für Identität, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit. Und aus meiner Zeit in der IT bringe ich die Erfahrung mit, komplexe Strukturen aufzubauen. Die Motivation kam vor allem aus der Feststellung, dass in Hamburg kein Raum vorhanden war, der Schwarze Perspektiven konsequent ins Zentrum stellt, in dem wir uns nicht nur über Rassismus definieren, sondern unsere ganze Vielfalt, Kreativität und Geschichte leben können.
Ehemalige Hauptstadt des deutschen Kolonialimus: Hamburgs Verantwortung
Hamburg gilt als inklusive, weltoffene Stadt. Wie ist die Situation für Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen hier?
Hamburg präsentiert sich gern als weltoffene, inklusive Stadt – und das ist auch ein Teil der Realität. Es gibt viele Initiativen, Begegnungsräume und eine wachsende Sensibilität für Vielfalt. Gleichzeitig erleben Schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen hier tagtäglich Rassismus: auf der Straße, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt durch Benachteiligungen oder in Behörden durch strukturelle Hürden.
Dass der Senat diese europaweit einzigartige Einrichtung nun nach nur zehn Jahren dichtmacht, wirft ein Schlaglicht auf die Halbherzigkeit der Hamburger Erinnerungspolitik.
Dr. Christian Ayivi
Hamburg war mit seinem Hafen die Hauptstadt des deutschen Kolonialismus. 2014 wurde hier die europaweit erste unabhängige Forschungsstelle für koloniales Erbe ins Leben gerufen. Dieses Jahr wurde sie geschlossen. Wie ordnen Sie das ein?
Die Schließung der Forschungsstelle ist ein politischer Rückschritt und ein fatales Signal. Hamburg war Drehscheibe des deutschen Kolonialismus – über den Hafen flossen Profite, Wissen und Gewaltbeziehungen, die bis heute nachwirken. Mit der Einrichtung der Forschungsstelle 2014 hatte Hamburg ein wichtiges Zeichen gesetzt: endlich die eigene Verantwortung ernsthaft und wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten. Dass der Senat diese europaweit einzigartige Einrichtung nun nach nur zehn Jahren dichtmacht, wirft ein Schlaglicht auf die Halbherzigkeit der Hamburger Erinnerungspolitik.
Der Name „Afrotopia“ ist inspiriert vom gleichnamigen Essay von Felwine Sarr. Inwieweit fließen diese Gedanken in Ihre Arbeit ein?
2023 hatten wir das besondere Glück, Felwine Sarr bei uns begrüßen zu dürfen. Tief beeindruckt nahm er wahr, dass seine Idee von Afrotopia hier eine konkrete Form gefunden hat. Gemeinsam konnten wir seine Philosophie eingehend diskutieren – die Forderung, dass Afrika sich jenseits westlicher Systeme neu erfinden müsse. Genau diese Vision wird in Hamburg durch konkrete Formate, Strukturen und Räume lebendig: Theorie wird hier zu Gestaltung, Austausch und Praxis.
Afrotopia sitzt in der ehemaligen Bugenhagenkirche. Was lieben Sie besonders an dem Gebäude?
Als Theologe und Sohn eines Pastors sind Kirchen für mich seit jeher Orte der Heimat. Besonders an der ehemaligen Bugenhagenkirche liebe ich ihren offenen, lichtdurchfluteten Kirchensaal mit den großen, schönen Fenstern. Der Raum strahlt Weite und Würde aus. Heute verleiht dieser Ort unserer Arbeit eine besondere Tiefe: Er verbindet Geschichte mit Zukunft und schafft einen Resonanzraum, in dem Schwarze Perspektiven sichtbar werden und neue Visionen wachsen können.